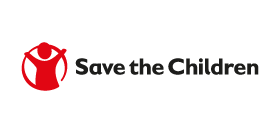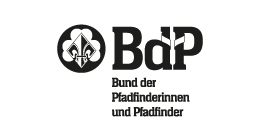Betroffengerechte
Prä- und Intervention
Machtmissbrauch, Diskriminierung & SEXUALISIERTE Belästigung UND GEWALT
Jede Form von Machtmissbrauch, angefangen bei geduldetem (Führungs-) Fehlverhalten bis hin zu herabwürdigendem Handlungen und Mobbing, können ein Klima der Ohnmacht begünstigen, welches ein Ansprechen von Diskrimierung, Sexismus, sexualisierter Belästigung und Gewalt viel weniger möglich macht.
Ehren- und Hauptamtliche, Kinder und Jugendliche vor grenzverletzendem, übergriffigem bis hin zu nötigendem / überwältigendem Verhalten zu schützen, liegt in der Verantwortung von Leitung und Führung jeder Organisation. Ein auf breite Akzeptanz angelegtes organisationsspezifisches Fürsorge – und Schutzkonzept schafft Handlungssicherheit in betroffenengerechter Prävention und Intervention von Machtmissbräuchen.

- Team & Netzwerk
- Prävention
- Intervention
- Inhouse
- Fachfortbildungen
Unser Kompetenzteam
Fürsorge- und Schutzkonzepte: Prävention auf drei Ebenen
Ein Fürsorge- und Schutzkonzept – ein MUSS für die wertvollen Räume, in denen sich Kindern und Jugendliche zwischen Selbstbestimmung und Grenzen entwickeln dürfen.
Und ein Fürsorgekonzept im Ehrenamt oder Arbeitsleben, welches die Fürsorgepflicht für alle Mitarbeitenden berücksichtigt und den Schutz vor Grenzverletzungen wie Belästigungen, Diskriminierung, Mobbing und Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung beinhaltet.
Primäre Prävention
Welche Maßnahmen nutzen wir, um die Haltung einzelner Menschen und die in unserer Organisation zu verändern? Auch um dadurch Fehlverhalten vorzubeugen?
Sekundäre Prävention – Intervention
Welche integeren Verfahren machen uns bei Meldung handlungsfähig? Wie können wir Vertraulichkeit garantieren und dadurch die Ansprechkultur von Fehlverhalten stärken? In welchen Fällen bleiben wir fehlerfreundlich und fordern Einsicht und Verhaltensänderung? Wie verhalten wir uns bei Aussage gegen Aussage?
Tertiäre Prävention – Nachhaltigkeit
Wie sichern wir die Qualität unseres Handelns? Wie überprüfen wir den Erfolg unseres Vorgehens? Wie nutzen wir Erfahrungen aus unserem Vorgehen und Erkenntnisse aus der Fachwelt zur Weiterentwicklung? Wie halten wir unser Konzept lebendig und veränderbar?
Bei Bedarf begleiten wir Sie im Prozess des Findens einer Steuerungsgruppe zur Ausarbeitung, Implementierung und Weiterentwicklung eines organisationsindividuellen Fürsorge- und Schutzkonzeptes.
Wir stehen zur sowohl punktuellen als auch zur regelmäßigen Moderation der Steuerungsgruppe zur Verfügung, bei der wir unsere Erfahrungen aus begleiteten Prozessen und unser Fachwissen mit einbringen.
Wir beraten Sie organisationsindividuell und arbeiten zusammen mit Ihnen die wesentlichen Bedarfe heraus.
Wir stehen Ihnen mit unserer Organisationsentwicklungs-, Implementierungs- und Mediationskompetenz zur Seite.
Gern empfehlen wir Ihnen auch Kolleg*innen aus unserem Beratungs- und Fachkräftenetzwerk (siehe Team & Netzwerk).
Gemeinsam mit Ihnen unterstützen wir die Veränderungen hin zu sichereren Orten – für Kinder und Jugendliche – für Mitarbeitende – für Ehrenamtliche.
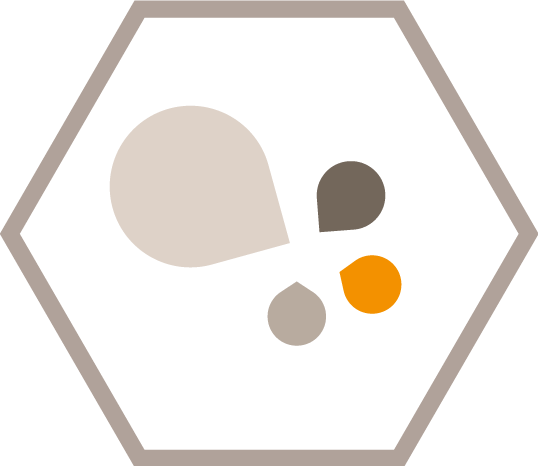
Lesen Sie auch gern unseren Artikel „Im Zweifel für unbekannte Betroffene! Ein Paradigmenwechsel im Umgang mit sexualisierter Belästigung und Gewalt“ in der Konfliktdynamik, Jahrgang 13 (2024), Heft 2. Hier eine Zusammenfassung. Wir freuen uns auf einen fachlichen Austausch. Bei Interesse sprechen Sie uns gerne an.
„Sexualisierte Belästigung und Gewalt in Organisationen sind verbreitet und oft durch mangelnde Meldungen und Sorge vor Stigmatisierung unaufgedeckt. Hier wird für einen Paradigmenwechsel plädiert: »Im Zweifel für unbekannte Betroffene«. Der Ansatz betont den Schutz möglicher Betroffener und erkennt an, dass Schweigen oft aus Angst vor weiterem Schaden resultiert. Vorteile des Paradigmenwechsels sind die erhöhte Meldebereitschaft, das Wachsen einer Feedback- und Entschuldigungskultur, systemisches und individuelles Lernen und ein daraus resultierender respektvollerer Umgang. Bedenken bezüglich falscher Anschuldigungen werden durch qualifizierte und vertrauliche Verfahren minimiert. Der Paradigmenwechsel macht im Dilemma »Aussage gegen Aussage« handlungsfähig und fördert Schutz und Fürsorge. Gemeldeten Menschen wird klar, dass ihr Ruf durch die Vertraulichkeit geschützt wird und sie gleichzeitig beim Steckenbleiben im Dilemma von „Aussage gegen Aussage“ das System verlassen müssen. Das motiviert zur Einsicht und Entschuldigung, wo diese möglich sind. Vor allem aber nimmt das Betroffene in einem System ernst, die bisher auf eine Meldung verzichtet haben.“
Betroffenengerechtes Fallmanagement
Fallmanagement meint das Finden eines fall- und organisationsindividuellen Umganges (Intervention) mit der vorliegenden Meldung.
Die Planung und Umsetzung fallindividueller Interventionen, die systemisch und damit über die meldenden und gemeldeten Menschen hinausgedacht werden müssen, übernimmt ein mit genügend fachlicher Qualifikation und disziplinarischer Macht ausgestattetes Interventionsteam. Die zu gehende Schritte verantwortet im Sinne der Verantwortungsübernahme die Führung der Organisation / des Systems.
Dabei geht es um ein bewusstes Aushalten des Dilemmas im möglichen Spannungsverhältnis zwischen Aussage und Widerspruch – im Gegensatz zu einem Entscheiden zwischen Wahr und Unwahr. Sollte im Laufe des fürsorglichen und vertraulichen Vorgehens das Dilemma erhalten bleiben, gilt es einen Umgang damit zu finden. Oft werden verantwortlich Handelnde von Menschen, die Kenntnis von dem Fall haben, bei jedem Ihrer Schritte kritisch beäugt, ihre Entscheidungen hinterfragt und manchmal werden sie als Person hart attackiert. Das erschwert ordentliches Handeln.
Handlungsleitend ist die Betroffenengerechtigkeit: inwieweit wirkt das Vorgehen und die Konsequenzen auf unbekannte Betroffene von Machtmissbräuchen und inwieweit durchbricht das Vorgehen die Strategien von diskriminierenden, mobbenden, sexualisiert belästigenden oder gewalttätigen Menschen.
Ein betroffenengerechten Fallmanagement unterliegt zum Schutz der Integrität aller und des Verfahrens an sich einer qualifizierten Vertraulichkeit. Diese Vertraulichkeit zu garantieren, liegt in der Verantwortung aller Systemangehörigen – Intervenierende weisen darauf ausdrücklich hin. Wenn die Vertraulichkeit verletzt wird, verlässt das Vorgehen die Möglichkeit eines betroffenengerechten Vorgehens. Durch die Verletzung werden die Systemangehörigen in ein Dilemma von ‘Glauben (wollen)’ und ‘Nicht wissen (können)’ katapultiert. Sie verspüren den Druck, sich entscheiden zu müssen: sich also entweder auf die Seite des ‘gemeldeten Menschen’ oder die Seite des oder der ‘meldenden Menschen‘ zu stellen – ein Konflikt mit hohem Spaltpotenzial.
Das System befindet sich buchstäblich in einer Krise, die dann gemanagt werden muss. Gelingt das Krisenmanagement, kann das vertrauliche und betroffenengerechte Fallmanagement fortgesetzt werden.
Unser Angebot
Wir unterstützen Sie und Ihre Organisation dabei, Sicherheit im Umgang mit dem systemisch-vertraulichen Vorgehen zu gewinnen, konsequent und betroffenengerecht zu intervenieren und dabei verantwortungsbewusst all Ihren Fürsorgepflichten nachzukommen:
- den Schutz von Betroffenen von Machtmissbrauch zu gewährleisten
- im Besonderen den Ruf des meldenden Menschen zu schützen
- auf den Rufschutz des gemeldeten Menschen (wenn benannt) achtzugeben
- und zugleich den Ruf Ihrer Mitarbeitenden und den Ruf Ihrer Organisation zu schützen
Etwaig auftretende Konflikte im Interventionsteams werden von uns begleitet.
Bei grenzverletzendem oder übergriffigem Verhalten unterstützen wir Sie beim Finden eines angemessenen Vorgehens im Sinne einer Verantwortungsübernahme des gemeldeten Menschen für das Verhalten und die Folgen.
Bei Bedarf begleiten wir den gemeldeten Menschen in der Einsicht und in der Verhaltensänderung.
Auch am Ende einer Regelung braucht es eine Nachsorge für alle involvierten Menschen – allem voran den meldenden Menschen, sicher auch für den gemeldeten Menschen (wenn bekannt).
Auf Grund unserer Erfahrung in der Moderation und Mediation von Gruppen und Teams finden wir ein für Sie passendes Format zur „Heilung des irritierten Systems“.
Auch im Krisenmanagement unterstützen wir Sie auf Grund unserer Expertise im Umgang mit hoch eskalierten Konflikten. Wenn das Fallmanagement erfolgreich abgeschlossen ist, unterstützen wir Sie bei der Fallanalyse und den aus den Erfahrungen resultierenden Learnings (systemische Verantwortungsübernahme) für Ihr präventives Schutz- bzw. Fürsorge- und Interventionskonzept (siehe „Prävention“).
Wir aktivieren und empfehlen Ihnen themenorientiert auch gern Kolleg*innen aus unserem Fachkräftenetzwerk (siehe „Team & Netzwerk“).
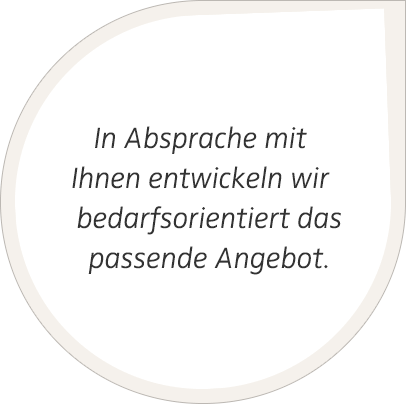
Lesen Sie auch gern unseren Artikel „Im Zweifel für unbekannte Betroffene! Ein Paradigmenwechsel im Umgang mit sexualisierter Belästigung und Gewalt“ in der Konfliktdynamik, Jahrgang 13 (2024), Heft 2. Hier eine Zusammenfassung. Wir freuen uns auf einen fachlichen Austausch. Bei Interesse sprechen Sie uns gerne an.
„Sexualisierte Belästigung und Gewalt in Organisationen sind verbreitet und oft durch mangelnde Meldungen und Sorge vor Stigmatisierung unaufgedeckt. Hier wird für einen Paradigmenwechsel plädiert: »Im Zweifel für unbekannte Betroffene«. Der Ansatz betont den Schutz möglicher Betroffener und erkennt an, dass Schweigen oft aus Angst vor weiterem Schaden resultiert. Vorteile des Paradigmenwechsels sind die erhöhte Meldebereitschaft, das Wachsen einer Feedback- und Entschuldigungskultur, systemisches und individuelles Lernen und ein daraus resultierender respektvollerer Umgang. Bedenken bezüglich falscher Anschuldigungen werden durch qualifizierte und vertrauliche Verfahren minimiert. Der Paradigmenwechsel macht im Dilemma »Aussage gegen Aussage« handlungsfähig und fördert Schutz und Fürsorge. Gemeldeten Menschen wird klar, dass ihr Ruf durch die Vertraulichkeit geschützt wird und sie gleichzeitig beim Steckenbleiben im Dilemma von „Aussage gegen Aussage“ das System verlassen müssen. Das motiviert zur Einsicht und Entschuldigung, wo diese möglich sind. Vor allem aber nimmt das Betroffene in einem System ernst, die bisher auf eine Meldung verzichtet haben.“
Macht – zwischen Fürsorge und Willkür
Sie möchten Ihr Wissen im Themenfeld Machtgebrauch und Machtmissbrauch erweitern, Ihre Mitarbeiter*innen schulen oder sensibilisieren?
Oder zusammen mit Kindern und Jugendlichen einen passenden Einstieg ins Thema Grenzen, Sexualität und sexualisierte Belästigung und Gewalt finden?
Wir oder Menschen aus unserem Beratungs- und Fachkräftenetzwerk (siehe „Team & Netzwerk“) bieten Vorträge, Trainings und Workshop-Module für Mitarbeitenden, Ehrenamtlichen, Führungskräfte Personal- und Betriebsräte direkt vor Ort an.
- Diskriminierung, Mobbing, sexualisierte Belästigung und Gewalt im Ehrenamt oder am Arbeitsplatz bzw. in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
- Diversity und Gendergerechtigkeit
- Entwicklung und Stärkung einer fehlerfreundlichen Ansprech- und Entschuldigungskultur
- Vermittlung von Faktenwissen, Betroffenenperspektive und Strategien der Machtmissbrauchenden
- Umgang mit Meldungen von Machtmissbräuchen
- Entwicklung von Fürsorge- und Schutzkonzepten
- Qualifizierung von Ansprechpersonen / Ombudspersonen
- Weiterbildung von internen Multiplikator*innen
- Sexualisierte Gewalt in der digitalen Welt
Darüber hinaus beraten und coachen wir Führungskräfte und Personal- bzw. Betriebsräte in der Implementierung von Schutz- und Fürsorgekonzepten (siehe Prävention) und der Intervention (siehe Intervention).
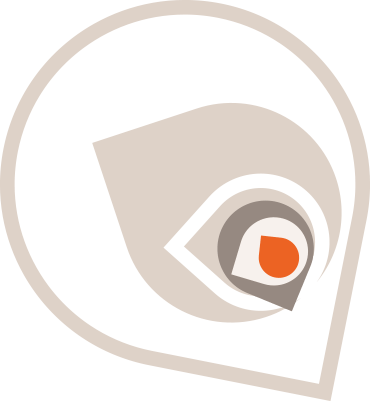
Fachfortbildungen
Die Anforderungen an Personalführende und ehrenamtliche Vorstände, an Organisationen im Profit- und Non-Profit-Bereich, an Parteien und politische Verbände und an Institutionen und Vereine in der Arbeit mit Kinder- und Jugendlichen haben sich durch #MeToo, #AidToo, Odenwaldschule und die Aufdeckungen in den Kirchen verändert.
Zu den herkömmlichen Aufgabengebieten gesellen sich hohe Ansprüche an Fachlichkeit und Handlungssicherheit im Themenfeld:
Eine Sensibilisierung im Bereich sexualisierter Belästigung und Gewalt und ein kompetenter Umgang mit Meldungen von Fällen wird vorausgesetzt, sowie die Unterstützung der von der Gewalt traumatisierten Betroffenen – sowohl Kinder und Jugendliche als auch Erwachsene.
Wir bieten zwei Qualifizierungsmöglichkeiten für Führungskräfte, Personalführende, ehrenamtliche Vorstände, Betriebsräte, Beauftragte und Ombudspersonen von Unternehmen und Firmen sowie Beratungsstellen und Engagierten in der Prävention und der Intervention an:
Die Fachfortbildung „Kein Raum für sexualisierte Gewalt“ richtet sich im Besonderen an Institutionen und Vereine in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
Die Fachfortbildung „Prävention sexualisierter Gewalt im Arbeitsleben“ richtet sich an Organisationen wie Firmen, Universitäten, Parteien und Vereine, in denen vornehmlich Erwachsene tätig sind.
Die Termine und die aktuellen Broschüren finden Sie unter Weiterbildungen auf dieser Website.

„Wir freuen uns sehr, unserem Anspruch an Lehre, Lernen und Atmosphäre durch die Kombination qualitativ hochwertiger gemeinsamer Zeit vor Ort mit erfahrungsreichen Onlinemodulen gerecht werden zu können.“

Unser Angebot: Wir unterstützen Sie im Fallmanagement nach Meldung auf Grund von Beobachtungen, Bauchgefühlen oder Erlebnissen im vertraulich systemischen Vorgehen im Sinne aller Ihrer Fürsorgepflichten.
Fachliche
Unterstützung und
Beratung
Finden von
systemintelligenten
fürsorglichen
Entscheidungen im
Vorgehen
Begleiten von
Reintegration bei
Einsicht / „Transport“
der Bitte um
Entschuldigung
Erarbeiten eines
fallindividuellen
Kommunikationsdesigns
Moderation von
Gesprächen und
Mediationen
Supervision und
Mediation der
Intervenierenden
Impulse beim
Finden von
Unterstützung für
meldende Menschen
und Betroffene*
Vorbereitung auf
Gespräche mit
gemeldeten Menschen
Rehabilitierung,
wenn gemeldete
Momente sich
zweifelsfrei ausschließen
lassen
Vorbereitung und
Begleitung von
Gesprächen mit
Teams, Gruppen,
Eltern, Kindern,
Jugendlichen
Öffentlichkeitsarbeit
Bestandteile eines Fürsorge- und Schutzkonzepts
-
Entwicklung
gemeinsamer
Sprache -
Fehlerfreundlichkeit
Ansprech- und Entschuldigungskultur -
Klare Haltung
Perspektive unbekannte Betroffene! -
Wie im Zweifel
Zugehörigkeit
auflösen … -
Richtlinie
oder DV / BV -
Passus in
Verträgen und
Vereinbarungen -
Schulungen,
Workshops,
Trainings,
Ansprachen -
Verhaltenskodex
-
Materialien
Flyer, Broschüren,
Plakate, … -
Kampagnen nutzen,
sich an Aktionen
beteiligen -
Informationen
über digitale
Kommunikation -
Potential- und
Risikoanalyse -
Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen
sexualpädagogisches
Konzept -
Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen
Führungszeugnisse
wann, wer,
wie , wo … -
Kontakt zu
externen Hilfen
Fachberatung,
Coaching, Mediation
Supervision -
UMFRAGEN
-
interne
Ansprechstelle
mit klarem Mandat
und ausreichend
Ressourcen -
transparente
Verfahren,
z.B. Visualisierung,
Flowchart -
Vertraulichkeits- und Transparenzprinzipien
DIE Grundlage eines betroffenengerechten Fallmanagenemts -
barrierefreie und
niederschwellige
Zugänge -
Zusammenarbeit
AGG-
Beschwerdestelle -
Möglichkeit schaffen
für betroffenen-
parteiliche Beratung
intern? extern? -
Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen
Zusammenarbeit
mit Ämtern Achtung:
Meldepflichten -
andere
Fachexpert:innenCoaching, rechtl.
Beratung, Supervision,
Mediation -
Nachsorge für das
„irritierte System“
und meldenden
Menschen -
Überprüfung der
Intervention,
Konsequenzen
Sanktionen -
Rehabilitierung
-
Monitoring
Qualitätsmanagement
z.B. Fallanalyse, etc. -
individuelle und
systemische
Verantwortungs-
übernahme -
UMFRAGEN
-
Aufarbeitung
Entwicklung gemeinsamer Sprache
Zur Definitionsmacht eines Systems gehört es, eine Begriffsbestimmung vorzugeben. Sowohl das mögliche Fehlverhalten als auch das Vokabular im fürsorgepflichtigen Feld und im Fallmanagement muss allen Angehörigen bekannt, geläufig und erklärbar sein. (Fragen Sie gerne nach von uns ausgearbeiteten Vorschlägen.)
„Vehlerfreundlichkeit“: Ansprech- und Entschuldigungskultur
In Organisationen mit fehlerfreundlicher Kultur, in der bei (Führungs-)-Fehlverhalten Feedback erlaubt ist und das Bitten um Entschuldigung zum guten Ton gehört, werden gemeldete Menschen es einfacher haben, bei grenzverletzendem und übergriffigem Verhalten im Feld sexualisierte Belästigung und Gewalt und bei grenzverletzendem und grenzüberschreitendem Verhalten im Feld Diskriminierung in eine Einsicht und Verhaltensänderung zu finden.
Die Zahl der Dilemmata „Aussage gegen Aussage“ können signifikant verringert werden.
Klare Haltung: Perspektive unbekannte Betroffene!!
Handlungsleitende Frage im Prozess der Implementierung und im Fallmanagement nach Meldung: Was würden dem System noch unbekannte Betroffene empfinden, schlussfolgern, denken?
Jegliches inner-systemisches Handeln in der Implementierung und Intervention muss das Signal senden, Beobachtungen oder eigenes Erleben frei von Bewertungen und Sanktionierungen melden zu dürfen.
Meldefreundlichkeit als ein empowerndes Signal an alle vulnerablen Personenkreise hat vor allem für Betroffene von Diskriminierung sowie sexualisierter Belästigung und Gewalt eine „heilende“ Wirkung – selbst wenn auf das Melden dennoch verzichtet wird.
Wie im Zweifel Zugehörigkeit auflösen?
Verfahren, in denen der gemeldete Mensch ein Forum erhält, um vor mehreren Menschen Stellung nehmen zu können oder lediglich versetzt wird, sendet an unbekannte Betroffene das Signal, dass ein „sich Melden“ eher Repressalien für sie bedeutet als eine fürsorgliche Lösung in ihrem Sinne.
Alle Menschen im System machen darüber hinaus die prägende Erfahrung, dass ein Verharren im „Aussage gegen Aussage“ für den Verbleib im System erfolgreich ist. Wenn Menschen dann gemeldet werden, greifen sie auf diese „Unternehmenskultur“ wie selbstverständlich zurück, statt ihr Verhalten einzuräumen und in ein Verlernen und Neulernen finden zu wollen.
Ist im System obengenannte Haltung „Perspektive der unbekannte Betroffenen!“ konsequent und allgemeinverbindlich anerkannt, ist gemeldeten Menschen klar, dass eine Verantwortungsübernahme für Verhalten und Folgen um Erhalt ihrer Systemzugehörigkeit dienen kann. Selbstverständlich braucht es dafür Vertraulichkeitsprinzipien, die den Ruf des Menschen schützen und Raum für Einsicht und Verhaltensänderung öffnen.
Systemindividuell muss geprüft werden, wie im Dilemma „Aussage gegen Aussage“ die Zugehörigkeit betroffenengerecht (—> unbekannte Betroffene) aufgelöst werden kann.
Nötigendes / überwältigendes Verhalten einzuräumen, birgt das Risiko, vor Gericht belangt werden zu können. Also werden gemeldete Menschen, die das Fehlverhalten verantworten, es genauso abstreiten, wie Menschen, denen es zu Unrecht unterstellt wird. Letztere können durch die Ruhe in einem vertraulichen Verfahren hoffen, dass sich im Laufe der Klärung die Vorhaltung als unbegründet herausstellt und sie Rehabilitierung (siehe tertiäre Präventionsebene) erfahren.
Richtlinie bzw. Dienst- oder Betriebsvereinbarungen
In einer Richtlinie bzw. Dienst- oder Betriebsvereinbarung als schriftliches Abkommen zwischen Arbeitgebenden und Arbeitnehmendenvertretung können zusätzlich zum Konzept die Standards, Verfahren und Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Unterstützung in Fällen von Konflikten, Machtmissbrauch, Diskriminierung, sexualisierter Belästigung und Gewalt festgelegt werden.
Thematischen Passus in Verträgen und Vereinbarungen integrieren
Thematische Passagen in Verträgen und Vereinbarungen sind spezielle Abschnitte oder Klauseln, die sich mit den unerwünschten Verhaltensweisen und dem systemindividuellen Umgang damit beschäftigen. Sie können verschiedene Bereiche abdecken, wie Prävention, Intervention, Unterstützungsleistungen und Verantwortlichkeiten nach einer Meldung. Darüber hinaus können auch Vertraulichkeits- und Transparenzprinzipien für Interventionen festgelegt und disziplinarische Maßnahmen bei Verstößen definiert werden.
Schulungen, Workshops, Trainings, Ansprachen
Für Führungskräfte, einschließlich Betriebs- oder Personalräten, sowie für Ansprechpersonen, die Meldungen bearbeiten müssen, sind regelmäßige Schulungen wesentlich für das Funktionieren des Konzeptes.
Workshops und Trainings für alle Systemzugehörigen, einschließlich Mitarbeitende und Ehrenamtliche, dienen der Vermittlung von Wissen über Präventionsmaßnahmen und Meldewege und fördern darüber hinaus eine Sensibilität für die Bedürfnisse und Rechte von Betroffenen.
Transparenz ist ein wesentlicher Grundsatz für den Aufbau von Vertrauen:
Regelmäßige Informationen über den Erfolg und den Stand der Konzeptarbeit sowie die Möglichkeiten zur Partizipation sollten bereitgestellt werden.
Informationen über gemeldetes Verhalten, anonymisiert und frei von anderen Wiedererkennungsmöglichkeiten, senden Signale des Erstnehmens an meldende Menschen und unbekannte Betroffene – aber auch Signale zur Reflexion von unerwünschten Verhaltensweisen.
Ansprachen auf Veranstaltungen mit Hinweisen zum Konzept und den Meldewegen tragen dazu bei, ein Bewusstsein für die Bedeutung der Themen zu schaffen und eine Kultur der Offenheit und Unterstützung zu fördern.
Berichte der Führung über das systemische Lernen durch die Auseinandersetzung mit den Themen an sich und den Fallmanagement-analysen sind Vorbildwirkung für das geforderte individuelle Lernen.
All das schärft das Bewusstsein für die Themen des Fürsorgekonzeptes und macht die Kultur des Ansprechens sowie die Kultur der individuellen als auch systemischen Verantwortungsübernahme erlebbar und erfahrbar.
Verhaltenskodex
Ein Verhaltenskodex stellt Normen für das erwünschte und unerwünschte Verhalten innerhalb einer Organisation oder Gemeinschaft dar. Bei seiner Formulierung ist es wichtig, dass die Verhaltensweisen klar und präzise beschrieben werden. Dies bedeutet, dass das Verhalten operationalisiert werden muss, das heißt, es müssen konkrete Handlungen oder Verhaltensweisen beschrieben werden, die als Beispiel für das gewünschte oder unerwünschte Verhalten dienen.
Das gewährleistet eine einheitliche Auslegung und Anwendung und gibt sowohl Menschen, die eine Verhalten erlebt haben, als auch Menschen, die ihr Verhalten prüfen wollen, eine Orientierung. Der Kodex stärkt die Meldefreundlichkeit und das individuelle Lernen der Systemzugehörigen.
Infos über Printmedien: Flyer, Broschüren, Poster
Es können existierende Flyer, Broschüren und Poster verwendet werden, die beispielsweise über UBSKM oder Antidiskriminierungsstelle zu beziehen sind. Natürlich können auch eigene konzeptindividuelle Printmedien erstellt werden, um über das Konzept und Meldewege zu informieren.
Kampagnen/ Aktionen nutzen und sich beteiligen
Kampagnen und Aktionen zum Beispiel von der Antidiskriminierung des Bundes, vom Bündnis gemeinsam gegen Sexismus oder auch Petitionen bei Change.org sowie Internationale Tage wie Weltfrauentag, Girls‘ Day, Internationaler Kindertag, Welttag der sexuellen Gesundheit, Tag der Zivilcourage, Tag der Bisexualität, Coming Out Day, Weltkindertag (Tag der Rechte des Kindes), Internationaler Tag gegen Gewalt gegen Frauen, Internationaler Tag der Menschen mit Behinderung, Welttag der Menschenrechte, Tag der UNICEF, Internationaler Tag der Migranten, Welt- Orgasmus-Tag, Internationaler Tag gegen Homo, Bi-, Inter- und Transphobie können als Anlass dienen, auf das Konzept und die daraus resultierenden Rechte und Pflichten zu verweisen.
Informationen über digitale Kommunikation
(Mails, Intranet, Socialmedia)
Nach dem Motto „Tue Gutes und rede darüber“ und im Sinne der Transparenz sollte es regelmäßige Informationen über die Arbeit in der Implementierung als auch über Veränderungen des Fürsorgekonzeptes auf verschiedensten Wegen geben.
Potenzial- und Risikoanalyse
Eine Potenzial- und Risikoanalyse ist eine Untersuchung, die dazu dient, die möglichen Gefahren und Risiken sowie die Chancen und Potenziale zu identifizieren. Dabei werden bestehende Risiken und Schwachstellen analysiert, um geeignete Maßnahmen zur Risikominderung zu entwickeln. Gleichzeitig werden Potenziale und Stärken ermittelt, um Möglichkeiten zur Optimierung und Weiterentwicklung zu erkennen und zu nutzen. Ziel dieser Analyse ist es, eine fundierte Grundlage für Entscheidungen zu schaffen und die Effektivität von Maßnahmen zu verbessern. Wir empfehlen ihnen gern Menschen aus unserem Beratungs- und Fachkräftenetzwerk. (siehe „Team & Netzwerk“).
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
sexualpädagogisches Konzept
Ein sexualpädagogisches Konzept fördert das Verständnis für sexuelle Grenzen, Einvernehmlichkeit und Respekt. Es bietet Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, gesunde Beziehungen aufzubauen und sich gegenüber Übergriffen zu behaupten. Durch Aufklärung und Sensibilisierung trägt es zur Prävention von sexualisierter Gewalt bei, indem es das Selbstbewusstsein stärkt und die Kommunikation über persönliche Grenzen erleichtert. Darüber hinaus brauchen gerade Kinder einen Wortschatz, um Teile ihres Körpers ordentlich benennen und Handlungen, die gegen ihre Willen geschehen, erkennen und beschreiben zu können.
Fragen Sie hierzu unsere Kolleg*innen von sexpäd.berlin (siehe „Team & Netzwerk“), die Ihnen sicher auch Beratungsmöglichkeiten in Ihrer Region empfehlen können.
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
Führungszeugnisse
In der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen muss eine Organisation abhängig von Art, Intensität und Dauer entscheiden, wer in welchen Abständen das erweiterte Führungszeugnis vorzulegen hat und wer mit der Dokumentation beauftragt wird.
Da im Führungszeugnis lediglich vor Gericht verhandelte und verurteilte Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung eingetragen werden, dient dieses Instrument eher der Abschreckung bereits verurteilter Straftäter:innen und hat aus unserer Sicht nur einen geringen präventiven Wert bei gleichzeitig hohem Verwaltungsaufwand.
Kontakt und Kooperation mit externen Hilfen
(Fachberatung, Coaching, Supervision, Mediation)
Um im Falle einer Meldung handlungsfähig zu sein und die richtigen qualifizierten Ansprechpartner:innen kontaktieren zu können, ist es ratsam, frühzeitig Kontakt mit externen Hilfen aufzunehmen und aufzubauen. Als Organisation ist es wichtig, sich zusammen mit dem individuellen Fürsorgekonzept vorzustellen.
Fachberatungsstellen für Betroffene von sexualisierter Gewalt können mit Kenntnis des Fürsorgekonzepts Menschen beraten, wie sie systemintern eine Meldung bereitstellen können.
Spezialisierte Beratungsstellen für Betroffene sexualisierter Gewalt bieten professionelle Hilfe und Unterstützung bei der Bewältigung von Traumata und anderen Folgen von Gewalterfahrungen. Eine enge Kooperation mit diesen Einrichtungen ermöglicht den Betroffenen einen leichteren Zugang zu Unterstützung.
Verantwortliche benötigen Fachberatung, um sich im Falle einer Meldung orientieren zu können.
Supervision zur Selbstfürsorge der Verantwortlichen sollte im Konzept verankert sein.
Im Feld fachlich qualifizierte Mediator:innen können sowohl dem Interventionsteam bei Konflikten zur Seite stehen als auch in konflikthaften oder eskalierten Situationen innerhalb der Organisation tätig werden.
Wir empfehlen Ihnen Menschen aus unserem Beratungs- und Fachkräftenetzwerk (siehe „Team & Netzwerk“).
Umfragen
Durch Umfragen können Unsicherheits- und Risikofaktoren sowie persönliche Erfahrungen und Beobachtungen abgefragt werden. Die Ergebnisse tragen dazu bei, die Dringlichkeit der Entwicklung eines Schutz- und Fürsorgekonzepts zu verdeutlichen.
Inspirationen für Fragen können Sie der Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes entnehmen.
Interne Ansprechstelle mit klarem Mandat und Ressourcen
Interne Ansprechpartner*innen sind Personen innerhalb einer Organisation oder Institution, die speziell benannt und ausgebildet wurden, um im Falle von Meldungen von Konflikten, Machtmissbräuchen, Diskriminierungen und sexualisierter Belästigung und Gewalt als erste Anlaufstelle zu dienen. Die Ansprechpartner*innen verfügen über das Mandat, angemessen auf Meldungen zu reagieren und Maßnahmen zum Schutz für Betroffene zu ergreifen. Sie kennen das Schutz- und Fürsorgekonzept und können gemäß diesem ein Interventionsteam zusammen mit Führung initiieren.
Um im Falle einer Meldung in Ruhe und mit Bedacht einen professionellen Umgang finden zu können, müssen sowohl die Ansprechpartner*innen als auch alle anderen verantwortlich Handelnden über genügend Ressourcen verfügen, die die Führung der Organisation gewährleisten muss.
Interne Ansprechstelle mit klarem Mandat und Ressourcen
Interne Ansprechpartner*innen sind Personen innerhalb einer Organisation oder Institution, die speziell benannt und ausgebildet wurden, um im Falle von Meldungen von Konflikten, Machtmissbräuchen, Diskriminierungen und sexualisierter Belästigung und Gewalt als erste Anlaufstelle zu dienen. Die Ansprechpartner*innen verfügen über das Mandat, angemessen auf Meldungen zu reagieren und Maßnahmen zum Schutz für Betroffene zu ergreifen. Sie kennen das Schutz- und Fürsorgekonzept und können gemäß diesem ein Interventionsteam zusammen mit Führung initiieren.
Um im Falle einer Meldung in Ruhe und mit Bedacht einen professionellen Umgang finden zu können, müssen sowohl die Ansprechpartner*innen als auch alle anderen verantwortlich Handelnden über genügend Ressourcen verfügen, die die Führung der Organisation gewährleisten muss.
Transparente Verfahren
Die Handlungsleitlinien und Verfahren im Falle einer Meldung sollten in einem Konzept für alle Lesenden klar und verständlich dargestellt werden. Dies kann durch eine nachvollziehbare Beschreibung ggf. in einfacher Sprache oder durch die Verwendung von Visualisierungen und Flussdiagrammen erreicht werden.
Vertraulichkeits- und Transparenzprinzipien – DIE Grundlage eines betroffenengerechten Fallmanagenemts
Im (gemeinsamen) Engagement gegen Machtmissbrauch, Diskriminierung, sexualisierte Belästigung und Gewalt geht es in erster Linie darum, sich als System vertrauenswürdig und ansprechbar zu zeigen.
Gerüchte und Gerede wirken vor allem auf noch unbekannte Betroffene. Sie schmälern das Vertrauen, ernst genommen und mit ihrem Anliegen respektiert zu werden. Die Furcht, stattdessen eher diskreditiert zu werden, erhöht die Hürde sich zu melden. Die innere Zerrissenheit radikalisiert sich (zu Recht) auf einem Spannungsbogen zwischen den Extremen „Despression und Rückzug / Ich verlassen das System“ und „Aggression und Wut – Wenn ich hier ernst genommen werden möchte, muss ich übertreiben“.
Hinzu kommt: Wie soll ein gemeldeter Mensch in einer Atmosphäre von Gerüchten und Gerede, was für ihn einen enormen Rufschaden bedeutet, statt sich zu verteidigen in eine Einsicht und Verantwortungsübernahme finden?
Ganz sicher kommt aus solchen Erfahrungen von „Verfahren“ ohne Vertraulichkeit die Idee, dass „immer irgend etwas hängen bleibt“.
Zum Schutze der Integrität eines betroffenengerechten Fallmanagements und aller darin eingebundenen Menschen – den verantwortlich Handelnden im Interventionsteam (Führung, qualifizierte Ansprechpersonen, Expert*innen, usw.), dem meldenden Menschen und dem gemeldeten Menschen – braucht es als Rahmung des Verfahrens eine garantierte qualifizierte Vertraulichkeit.
Jede Organisation muss einen Weg finden, die Vertraulichkeitsprinzipien disziplinarisch zu unterlegen.
Zu den Transparenzprinzipien zählt, dass alle vom Fall Wissenden regelmäßig über den Stand des Fallmanagements (innerhalb der rechtlichen Rahmenbedingungen) informiert werden müssen. Menschen, die einmal von einem Fall „in ihrer Nähe“ erfahren haben, werden sich sonst andere Wege suchen, an diese Informationen zu gelangen. Das wiederum kann zu Gerüchten und Gerede führen.
Fragen Sie gern bei uns nach, welche Ideen wir auf Grund unserer Erfahrungen als Vorlage für Fürsorgekonzepte und das Vorgehen im Fallmanagement entwickelt haben (praevention@inmedio.de).
Barrierefreie und niedrigschwellige Zugänge
Barrierefreie und niederschwellige Zugänge sind wichtige Maßnahmen, um sicherzustellen, dass alle Systemangehörigen Zugang zu Unterstützung und Hilfe haben, unabhängig von ihren individuellen Bedürfnissen und Umständen. Einige Beispiele für solche Zugänge könnten sein: Mehrsprachige Informationen und Unterlagen, barrierefreie Kommunikation, barrierefreie Zugänge zu physischen Räumen, in denen Beratung und Unterstützung angeboten werden, besondere Angebote für vulnerable Gruppen.
Zusammenarbeit AGG Beschwerdestelle
In Organisationen mit Arbeitnehmenden ist es hilfreich, eine Beschwerdestelle gemäß den Bestimmungen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) einzurichten. Dadurch können einerseits Meldungen als AGG- Beschwerden entgegengenommen und sowohl gemäß dem AGG-Verfahren als auch den Handlungsleitlinien des Konzepts behandelt werden. Andererseits kann die AGG-Fachkraft nach Meldungseingang prüfen, ob ein AGG-Beschwerdeverfahren möglich ist. Das Interventionsteam, welches die AGG-Fachkraft inkludiert, kann dann entscheiden, welche Empfehlungen sie dem meldenden Menschen ausspricht.
Für weitere Informationen zur AGG-Beschwerdestelle wenden Sie sich gern an ZuZ Handeln.
Möglichkeit für betroffenenparteiliche und vertrauliche Beratung
Neben der systeminternen Meldung, die kausal eine Intervention nach sich zieht, müssen Menschen ebenfalls die Möglichkeit haben, sich rein vertraulich und, wenn betroffen von Diskriminierung oder sexualisierter Gewalt, auch betroffenenparteilich beraten lassen zu können. Inwiefern das ebenfalls intern möglich ist, muss eine Organisation prüfen. Die Zusammenarbeit mit Fachberatungsstellen für diese Form der Beratung braucht es unbedingt (siehe externe Hilfen auf der primären Ebene).
Fragen Sie hierzu unsere Kolleg*innen aus unserem Beratungsnetzwerk (siehe „Team & Netzwerk“), die Ihnen Beratungsmöglichkeiten in Ihrer Region empfehlen können.
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
Zusammenarbeit mit Ämtern (Achtung: Meldepflichten)
Organisationen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, müssen vor allem in Bezug auf die Meldepflicht eine enge Zusammenarbeit mit anderen relevanten Akteuren sicherstellen.
Jugendämter oder Kinder- und Jugendhilfestellen sind Anlaufstellen für den Schutz von Kindern und Jugendlichen. Sie können unterstützende Maßnahmen einleiten und notwendige Schutzvorkehrungen treffen.
Auch die Zusammenarbeit mit Polizei und Justizbehörden und mit medizinischem Fachpersonal und Therapeut*innen ist zu prüfen.
Durch eine effektive Zusammenarbeit mit diesen Akteuren können Organisationen sicherstellen, dass Meldungen angemessen behandelt und Betroffene bestmöglich unterstützt werden.
Andere Fachexpert*innen
(Coaching, Supervision, Mediation, rechtliche Beratung, etc.)
Wie bereits bei der primären Ebene erwähnt, ist die Zusammenarbeit mit anderen Fachexpert*innen von entscheidender Bedeutung. Auf sekundärer und tertiärer Ebene der Prävention ist zusätzlich eine juristische Beratung erforderlich, sowohl im arbeitsrechtlichen als auch im strafrechtlichen Kontext.
Schauen Sie sich unter „Team & Netzwerk“ unser Kompetenzteam und unser Beratungs- und Fachkräftenetzwerk an und fragen Sie gern nach unseren Empfehlungen.
Nachsorge für das „irritierte System“ und meldende Menschen
Auch nachdem eine angemessene Bearbeitung der Meldung erfolgt ist, ist es wichtig, weiterhin alle Beteiligten – vor allem die von dem Fall Wissenden – im Blick zu behalten und zu prüfen, welche Unterstützung sie benötigen, um aus einer sie u.U. belastenden Situation herauszufinden. Das gilt insbesondere für die/den meldenden Menschen.
Unser Kompetenzteam berät Sie gern.
Überprüfung der Intervention / Konsequenzen / Sanktionen
Es ist essenziell, Interventionen und deren Konsequenzen / Sanktionen nach einer Meldung dahingehend prüfen, ob die getroffenen Maßnahmen effektiv sind, den meldenden Menschen und allen anderen Beteiligten inklusive des gemeldeten Menschen die nötige Unterstützung zukam und dadurch künftige Vorfälle vermieden werden können.
Rehabilitierung
Die Rehabilitierung nach einer Fehl- oder Falschbeschuldigung ist ebenfalls ein sensibler und komplexer Prozess, der Einfühlungsvermögen, Unterstützung und Zeit erfordert. Menschen, die zu Unrecht beschuldigt wurden, erleben oft eine Vielzahl von negativen Auswirkungen auf ihre psychische Gesundheit, soziale Beziehungen und berufliche Möglichkeiten. Es ist wichtig, ihre Reputation in allen Bereichen, in denen die Beschuldigung bekannt war, wiederherzustellen.
Durch eine einfühlsame und unterstützende Herangehensweise können Menschen, die zu Unrecht beschuldigt wurden, die Unterstützung erhalten, die sie benötigen, um ihr Leben wieder aufzubauen und sich von den negativen Auswirkungen der Fehlbeschuldigung zu erholen.
Lassen Sie sich durch unser Kompetenzteam beraten. Wir empfehlen Ihnen Menschen neben uns bei Bedarf Menschen aus unserem Beratungs- und Fachkräftenetzwerk (siehe „Team & Netzwerk“).
Monitoring (Qualitätsmanagement), z.B. Fallanalyse etc.
Nach der Bearbeitung von Fällen sind ein kontinuierliches Monitoring und Qualitätsmanagement von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass angemessene Maßnahmen ergriffen und die meldenden Menschen adäquat unterstützt wurden. Besonderer Fokus bei der Betrachtung liegt auch wieder auf unbekannten Betroffenen. Dies beinhaltet die regelmäßige Überprüfung der durchgeführten Verfahren und Maßnahmen, um mögliche Schwachstellen oder Verbesserungspotenziale zu identifizieren. Darüber hinaus ist es wichtig, die Wirksamkeit der implementierten Fürsorge- und Schutzmaßnahmen zu evaluieren und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen, um einen effektiven Schutz vor zukünftigen Vorfällen zu gewährleisten.
Eine Fallanalyse bietet einen Weg, um das geschilderte Fehlverhalten in Bezug auf Angebote, Einrichtungen, Art der Vorfälle, sowie Zeitpunkt und Reaktion der Verantwortlichen zu beleuchten.
Das gehört zu den wesentlichen Aufgaben einer Steuerungsgruppe nach der Implementierung.
individuelle und systemische Verantwortungsübernahme
Verantwortungsübernahme auf Seiten des gemeldeten Menschen ist ein komplexer und ggf. langwieriger Prozess, der das Verbleiben im System des gemeldeten Menschen ermöglichen soll. Er erfordert Einfühlungsvermögen, Unterstützung und Zeit, um das Vertrauen in die Zusammenarbeit wiederherzustellen und den Heilungsprozess für alle Beteiligten zu unterstützen.
Die Übernahme der Verantwortung für das an den Tag gelegte Verhalten an sich und dem Schaden bzw. der Verletzung, der bzw. die sich daraus mind. für den meldenden Menschen ergeben hat, müssen authentisch sein. Der gemeldete Mensch muss sich aktiv an der Wiedergutmachung beteiligen, indem beispielsweise unterstützende Hilfe (Beratungsstellen / Coaching / etc.) gesucht wird.
Wenn im Prozess der Wunsch beim gemeldeten Menschen entsteht, um Entschuldigung bitten zu wollen, sollten der meldende Mensch die Möglichkeit haben, die Entschuldigung anzunehmen oder abzulehnen, je nach den eigenen Bedürfnissen und Gefühlen. Dafür bedarf es Unterstützung.
Die Führung der Organisation muss letztendlich bewerten, wie authentisch sie den Prozess des gemeldeten Menschen findet und über weitere Maßnahmen bzw. dem Verbleib in der Organisation entscheiden.
Verantwortungsübernahme seitens der Führung der Organisation zeigt sich in der konsequenten vertraulichen und betroffenengerechten (unbekannte Betroffene) Bearbeitung von Meldungen im Fallmanagement sowie der Reflexion, wie sich dieser spezifische Fall ggf. durch weiterreichende Maßnahmen auf den Präventionsebenen hätte verhindern lassen können, ggf. verbunden mit dem Eingestehen von „Fehlern“ (als Vorbildfunktion).
Umfragen
Umfragen auf der Ebene der tertiären Prävention haben das Ziel, die Veränderungen in der Organisation nach Einführung des Konzepts hinsichtlich individueller und struktureller Unsicherheits- und Risikofaktoren zu erfassen. Zudem können die Wirksamkeit der Präventionsmaßnahmen und die Erfahrungen mit Interventionen untersucht werden. Auf diese Weise werden Hinweise gewonnen, welche Bereiche des Konzepts Verbesserungen benötigen.
Aufarbeitung
Durch die Auseinandersetzung mit Fällen und Atmosphären in der Vergangenheit können Organisationen auch strukturelle Probleme und Versäumnisse identifizieren, die zu Fällen von Diskriminierung u.o. sexualisierter Belästigung und Gewalt geführt und deren Aufdeckung verhindert haben. Dies ermöglicht es, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um Ähnliches in Zukunft zu verhindern und eine sicherere Umgebung für alle Mitglieder der Organisation zu schaffen. Auch ist es durch Aufarbeitung möglich, die systemische Verantwortung für Fälle in der konzeptfreien oder -armen Zeit zu übernehmen und das Leid an Betroffenen anzuerkennen und zu unterstützen.
Darüber hinaus trägt die historische Aufarbeitung dazu bei, das Bewusstsein für die Bedeutung von Prävention und Intervention zu schärfen und die Kultur innerhalb der Organisation zu verändern, um Diskriminierung u.o. sexualisierte Belästigung und Gewalt aktiv zu bekämpfen.
Die Frage von Aufarbeitung ist weniger eine Frage des „ob“ sondern mehr eine Frage des „wann“.
Betroffenengerechte Herangehensweise
Handlungsleitend in der Begleitung ist für uns die Frage, wie aus Ihrer Sicht Ihr Vorgehen in der Implementierung auf Ihnen noch unbekannte Betroffene von Machtmissbräuchen wirken und inwieweit das die Strategien von diskriminierenden, mobbenden, sexualisiert gewalttätigen Menschen durchbricht.
Wir aktivieren und empfehlen Ihnen themenorientiert auch gern Kolleg*innen aus unserem Fachnetzwerk (siehe Team & Netzwerk).
Betroffenengerechtes Fallmanagement
Handlungsleitend in der Begleitung ist für uns die Frage, wie aus Ihrer Sicht Ihr Vorgehen und die Konsequenzen auf Ihnen noch unbekannte Betroffene von Machtmissbräuchen wirken und in wie weit das die Strategien von diskriminierenden, mobbenden, sexualisiert gewalttätigen Menschen durchbricht.
Wenn das Fallmanagement erfolgreich abgeschlossen ist, unterstützen wir Sie bei der Fallanalyse und den aus den Erfahrungen resultierenden Konsequenzen für Ihr präventives Schutz- bzw. Fürsorge- und Interventionskonzept.